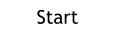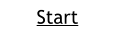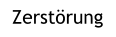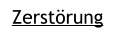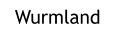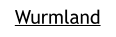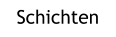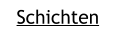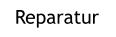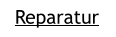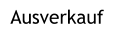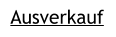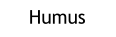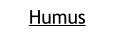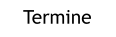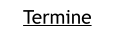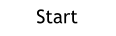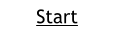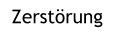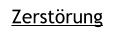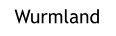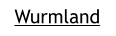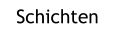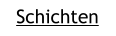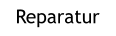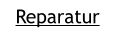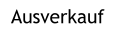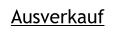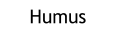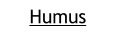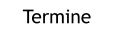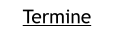Rettet den Boden!

Kontakt

Impressum


Wie die Landwirtschaft vom Klimasünder zum Klimahelfer wird
Die
Pariser
Klimakonferenz
hat
2015
nicht
nur
das
Klimaab-
kommen
verabschiedet,
das
bislang
nicht
umgesetzt
ist.
Sie
hat
auch
die
Vier-Promille-Initiative
beschlossen,
eingebracht
von
den
Franzosen,
unterstützt
von
Deutschland.
Die
Idee:
Wir
bauen
in
allen
landwirtschaftlich
genutzten
Böden
der
Erde
jährlich
vier
Prozent
zusätzlichen
Humus
auf.
Damit
wäre
dann
der
jährliche
Ausstoß
an
menschgemachtem
CO2
als
Kohlenstoff
in
den
Böden
gebunden.
Der
Humusaufbau
in
den
Böden
würde
uns
Zeit
schenken,
um
den
Klimawandel
doch
noch
in
den
Griff
zu
bekommen.
Derzeit
geschieht
das
Gegenteil:
Unsere
Form
der
industrialisierten
Landwirtschaft
verliert
den
Humus
der
Böden
und
setzt
damit
zusätzliche
Treibhausgase frei.
Das
aber
ist
umkehrbar.
Die
Wirtschaftsweise,
die
notwendig
ist,
um
Humus
in
den
Böden
aufzubauen,
ist
weitgehend
bekannt
und
wird
von
manchen
Bauern
auch
schon
viele
Jahre
und
zum
Teil
Jahrzehnte
angewandt:
die
sogenannte
Regenerative
Landwirtschaft.
Friedrich
Wenz,
einer
der
Pioniere,
der
sich
heute
mit
einem
Kollegen
zusammen
auf
die
Weitergabe
seines
Wissens
bei
Seminaren
und
öffentlichen
Feldtagen
mit
Vorführungen
auf
verschiedenen
Höfen
konzentriert, beschreibt das auf seiner Internetseite so:
»
Die
Regenerative
Landwirtschaft
ist
die
Wiederherstell-
ung
des
lebend
verbauten
Kohlenstoffes
im
Boden
durch
Humusaufbau
aus
atmosphärischem
Klimagas.
Sie
ist
die
Wiederherstellung
der
mikrobiellen
Prozesse
im
Boden
durch
die
Förderung
der
Interaktion
Pflanzen-Bodenleben
und
damit
auch
der
hohen
Nährstoffgehalte
in
pflanzlichen
Produkten.
Die
Regenerative
Landwirtschaft
basiert
auf
Methoden
und
Verfahren, die die Naturgesetze unterstützen.«
Die
Bewegung
für
mehr
Bodengesundheit
und
Humusaufbau
geht
inzwischen
aber
auch
über
die
Kreise
der
Bauern,
zumal
der
Biobauern,
hinaus.
Die
Naturschutzorganisation
WWF
Deutschland
zum
Beispiel
hat
einen
Arbeitskreis
eingerichtet,
in
dem
sich
seit
2016
am
Boden
interessierte
Naturschützer
mit
Bauern
treffen.
Nach
sechs
Treffen
hat
der
Gesprächskreis
2018
ein
Papier
mit
Arbeitsthesen
zum
»
Lebendigen
Boden
als
gemeinsamer
Basis
für
Landwirtschaft
und
Naturschutz
«
vorgelegt;
als
Grundlage
für
weitere
Treffen
von
Bauern
und
Naturschützern.
In
der
Diskussion
und
in
den
Arbeitsthesen
werden
Naturschutz
und
Landwirtschaft,
die
sich
an
vielen
Stellen
auf
dem
Land
oft
recht
unversöhnlich
gegenüberstehen,
zusammen
gedacht
und
die
Erhaltung
der
fruchtbaren
Böden
wird
zur
gemeinsamen
Naturschutzaufgabe.
Es
sei
ein
Bodenbild
erforderlich,
das
über
eine
Sichtweise
des
Bodens
als Rohstoff und Dienstleister hinausgeht:
»Eine
Landwirtschaft,
die
intensiv
mit
Monokulturen
oder
engen
Fruchtfolgen
arbeitet,
die
stark
chemisch
und
mechanisch
in
den
Boden
eingreift
oder
mit
zu
hohem
Viehbesatz
pro
Hektar
wirtschaftet,
verringert
die
Mächtigkeit,
Lebensvielfalt
und
natürliche
Produktivität
der
ursprünglichen
Böden.
Es
ist
eine
gemeinsame
gesellschaftliche
Aufgabe,
diese
Abbauprozesse
umzukehren
und
einen
wirklich
nachhaltigen
Landbau zu gestalten.«
Pfluglose Biolandwirtschaft
Dass der Pflug dem Bodenleben nicht guttut, wissen Landwirte schon lange. Sepp Braun aus
Freising, bekannt geworden als der Regenwurm-Bauer, sagt: »Das ist ungefähr so, als wenn ich
jung verheiratet bin und gerade das Haus für meine Familie fertig hab, und dann kommt jedes Jahr
ein Sturm und reißt mir das Dach herunter.« Jedes Jahr hat das Bodenleben sich gerade von oben
nach unten neu organisiert, wenn geerntet wird und dann der Pflug kommt - zwei Katastrophen auf
einmal. Die erste ist die Ernte: Sie reißt dem Bodenleben die Nahrungsgrundlage fort. Die zweite
Katastrophe ist der Pflug: Er dreht dem Bodenleben die obere Schicht auf den Kopf und zerstört
alles, was in einem Jahr aufgebaut wurde.
Um den Pflug zu ersetzen, propagierte die Agrarindustrie über vier Jahrzehnte lang Glyphosat.
Damit ließen sich die Wurzelunkräuter problemlos bekämpfen. Ohne Glyphosat oder ähnliche
Agrarchemie braucht man den Pflug, sagen auch viele Biolandwirte. Es gibt aber längst auch
mechanische Geräte - besondere Grubber - mit denen die Unkräuter, die tief wurzeln, bekämnpft
werden können.
Die Bauern, die humusaufbauende Landwirtschaft betreiben, sind häufig gezwungen, sich ihre
eigenen Landmaschinen zu entwickeln. So auch Sepp Hägler, der den Vorteil hat, dass sein
Schwiegersohn Landmaschinenmechaniker ist. Andere Betriebe, wie der Gemüsehof Dickendorf im
Westerwald, haben dafür extra Techniker einstellen.

Warum wir um das Leben unter unseren Füßen kämpfen müssen
So nicht!

Rettet den Boden!
Warum wir um das Leben
unter unseren Füßen kämpfen müssen

Kontakt

Impressum

Wie die Landwirtschaft vom Klimasünder zum Klimahelfer wird
Die
Pariser
Klimakonferenz
hat
2015
nicht
nur
das
Klimaab-
kommen
verabschiedet,
das
bislang
nicht
umgesetzt
ist.
Sie
hat
auch
die
Vier-Promille-Initiative
beschlossen,
eingebracht
von
den
Franzosen,
unterstützt
von
Deutschland.
Die
Idee:
Wir
bauen
in
allen
landwirtschaftlich
genutzten
Böden
der
Erde
jährlich
vier
Prozent
zusätzlichen
Humus
auf.
Damit
wäre
dann
der
jährliche
Ausstoß
an
menschgemachtem
CO2
als
Kohlenstoff
in
den
Böden
gebunden.
Der
Humusaufbau
in
den
Böden
würde
uns
Zeit
schenken,
um
den
Klimawandel
doch
noch
in
den
Griff
zu
bekommen.
Derzeit
geschieht
das
Gegenteil:
Unsere
Form
der
industrialisierten
Landwirtschaft
verliert
den
Humus
der
Böden
und
setzt
damit
zusätzliche
Treibhausgase frei.
Das
aber
ist
umkehrbar.
Die
Wirtschaftsweise,
die
notwendig
ist,
um
Humus
in
den
Böden
aufzubauen,
ist
weitgehend
bekannt
und
wird
von
manchen
Bauern
auch
schon
viele
Jahre
und
zum
Teil
Jahrzehnte
angewandt:
die
sogenannte
Regenerative
Landwirtschaft.
Friedrich
Wenz,
einer
der
Pioniere,
der
sich
heute
mit
einem
Kollegen
zusammen
auf
die
Weitergabe
seines
Wissens
bei
Seminaren
und
öffentlichen
Feldtagen
mit
Vorführungen
auf
verschiedenen
Höfen
konzentriert, beschreibt das auf seiner Internetseite so:
»
Die
Regenerative
Landwirtschaft
ist
die
Wiederherstell-
ung
des
lebend
verbauten
Kohlenstoffes
im
Boden
durch
Humusaufbau
aus
atmosphärischem
Klimagas.
Sie
ist
die
Wiederherstellung
der
mikrobiellen
Prozesse
im
Boden
durch
die
Förderung
der
Interaktion
Pflanzen-Bodenleben
und
damit
auch
der
hohen
Nährstoffgehalte
in
pflanzlichen
Produkten.
Die
Regenerative
Landwirtschaft
basiert
auf
Methoden
und
Verfahren, die die Naturgesetze unterstützen.«
Die
Bewegung
für
mehr
Bodengesundheit
und
Humusaufbau
geht
inzwischen
aber
auch
über
die
Kreise
der
Bauern,
zumal
der
Biobauern,
hinaus.
Die
Naturschutzorganisation
WWF
Deutschland
zum
Beispiel
hat
einen
Arbeitskreis
eingerichtet,
in
dem
sich
seit
2016
am
Boden
interessierte
Naturschützer
mit
Bauern
treffen.
Nach
sechs
Treffen
hat
der
Gesprächskreis
2018
ein
Papier
mit
Arbeitsthesen
zum
»
Lebendigen
Boden
als
gemeinsamer
Basis
für
Landwirtschaft
und
Naturschutz
«
vorgelegt;
als
Grundlage
für
weitere
Treffen
von
Bauern
und
Naturschützern.
In
der
Diskussion
und
in
den
Arbeitsthesen
werden
Naturschutz
und
Landwirtschaft,
die
sich
an
vielen
Stellen
auf
dem
Land
oft
recht
unversöhnlich
gegenüberstehen,
zusammen
gedacht
und
die
Erhaltung
der
fruchtbaren
Böden
wird
zur
gemeinsamen
Naturschutzaufgabe.
Es
sei
ein
Bodenbild
erforderlich,
das
über
eine
Sichtweise
des
Bodens
als Rohstoff und Dienstleister hinausgeht:
»Eine
Landwirtschaft,
die
intensiv
mit
Monokulturen
oder
engen
Fruchtfolgen
arbeitet,
die
stark
chemisch
und
mechanisch
in
den
Boden
eingreift
oder
mit
zu
hohem
Viehbesatz
pro
Hektar
wirtschaftet,
verringert
die
Mächtigkeit,
Lebensvielfalt
und
natürliche
Produktivität
der
ursprünglichen
Böden.
Es
ist
eine
gemeinsame
gesellschaftliche
Aufgabe,
diese
Abbauprozesse
umzukehren
und
einen
wirklich
nachhaltigen
Landbau zu gestalten.«


Die Humuswende
Untersaat im Mais: Der Boden bedeckt und durchwurzelt
Nach der Maisernte: Erosionsschutz und Futter für Regenwürmer